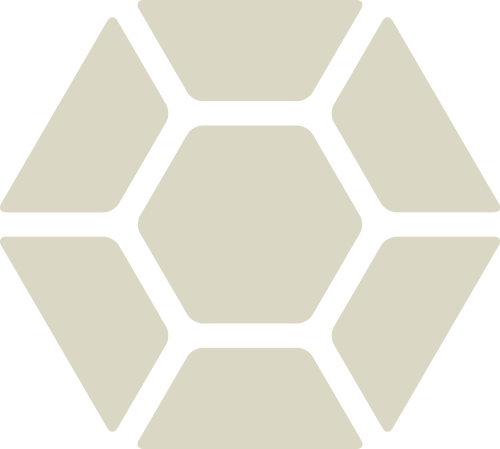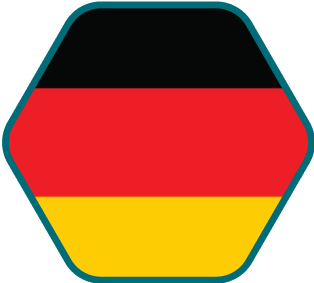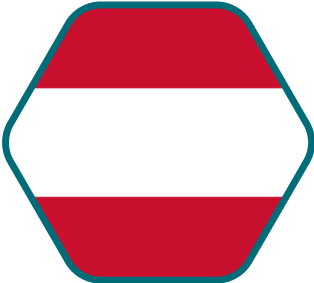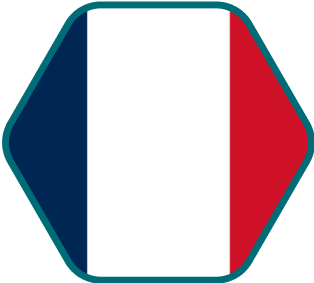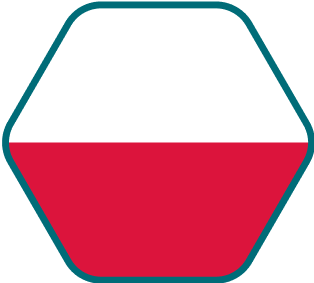HPC gegen Papierschlämme
Papierschlämme verunreinigten Ackerflächen und Grundwasserleiter in Baden-Württemberg. Über Ursachen und Lösungen dieser großflächigen Kontamination.
Das Glück analysierte mit: Nach einem Brand in Baden-Baden haben die dortigen Wasserwerke ihr Rohwasser auf polyfluorierte Chemikalien (PFC) überprüft. Schließlich wurde bei der Brandbekämpfung ein filmbildender Löschschaum eingesetzt, der in das Grundwasser gesickert ist. Solche Schäume enthalten Perfluoroctansulfonsäure, ein PFC. Sie sind bei Unfällen mit Tanklastzügen, Flugzeugunglücken oder Bränden in Raffinerien benutzt worden. Seit 2011 sind sie verboten.
Das Überraschende: PFC waren bei Weitem nicht nur in der Schadstofffahne, also in dem verschmutzten Wasser in Fließrichtung des Grundwassers feststellbar. Großflächig wurden PFCs festgestellt, allerdings weniger solche Chemikalien, die für Löschschaum eingesetzt wurden. Stattdessen fanden die Analysten zunehmend Perfluoroctansäure. Dieser Zusatz wird beispielsweise für die Antihaftbeschichtung von Pizzakartons und Butterbrotpapier oder die wasserundurchlässige Schicht von Kaffee-Einwegbechern verwendet.
Viele finden diese PFCs im Alltag also ziemlich praktisch. Allerdings können sie auch giftig und abhängig von der Konzentration krebserregend wirken, wie Frau Bernadette Bohnert erläutert, Fachbereichsleiterin für Altlasten bei HPC in Stuttgart.
Problematisch ist, dass sich PFC in Pflanzen, Tieren und letztendlich im Menschen ansammeln können. Noch problematischer sind ihr massenhaftes Auftreten, die schlechte Abbaubarkeit und die zunächst nicht restlos geklärte Herkunft in Baden-Baden.
Das Maul des geschenkten Gauls
Schließlich fanden sich Hinweise, dass Bauern zwischen 2005 und 2008 teilweise unwissentlich Papierschlämme als Kompost auf Ackerflächen ausgebracht hatten. Seit 2005 dürfen diese Abfälle aus der Papierproduktion nämlich nicht mehr auf Deponien entsorgt werden. In Deutschland fallen jedoch jährlich mehrere Millionen Tonnen Papierschlämme an.
Ein Kompostunternehmen aus Bühl in Baden-Baden kaufte mehr als 100.000 Tonnen solcher Schlämme auf, vermischte sie mit Kompost und verschenkte diese Mischungen an Landwirte. Mehr als 1.000 Hektar Ackerland in Baden-Württemberg sind in irgendeiner Form von der PFC-Belastung betroffen.
Nicht alle Landwirte haben den kostenlosen Kompost angenommen. Manche von ihnen haben verunreinigten Boden gekauft, gepachtet oder getauscht. Doch nicht nur der Boden ist verschmutzt: Unter den Äckern liegt der Oberrhein-Aquifer, einer der größten Grundwasserleiter Europas. Die badischen Böden wiederum sind bekannt für ihre Wasserleitfähigkeit. Vergleichsweise schnell dringen Schadstoffe mit Sickerwasser bis in das Grundwasser. Nach Schätzung der Rastatter Wasserwerke sind mindestens 130 Millionen Kubikmeter Grundwasser betroffen.
Viele Bauern können heute schon nicht mehr ihr eigenes Wasser für die Bewässerung ihrer Felder nutzen oder müssen es zumindest vorher reinigen.
Und jetzt?
“Bei solchen großflächigen Verschmutzungen lässt sich die Ursache leider kaum beheben”, so Bernadette Bohnert. “Bei stadtnahen Flächen heißt es dann: Gewerbegebiete statt Spielplätze, Oberflächen versiegeln und keine Keller zulassen. Auch um Aushub zu vermeiden, denn den will niemand haben.” Doch die Fläche ist nicht nur zu groß, um sie für Parkplätze und Gewerbeflächen zu asphaltieren und zu betonieren. Die Tragik ist, dass es sich bei diesen Böden um fruchtbare Ackerflächen handelt. Auch das Wasser wird weiterhin genutzt. “Wo Grundwasser entnommen wird, wird das Grundwasser bei Bedarf selbstverständlich gereinigt”, erläutert Bernadette Bohnert.
Wie mit der PFC-Kontamination umgegangen wird, ist also nutzungs- und ortsabhängig. Es gibt Anlagen, in denen PFC chemisch gebunden und aus abgepumptem Wasser herausgefiltert wird. Die Stadtwerke Baden-Baden installierten derweil eine Anlage zur Niederdruck-Umkehr-Osmose, die Rastatter Wasserwerke einen Aktivkohlefilter.
Nicht nur die verschiedenen Technologien der Altlastensanierung und Wasserfilterung helfen bei der PFC-Herausforderung. Landwirte haben auch mit der Fruchtfolge einen Einfluss: In Versuchen wurde nachgewiesen, dass etwa Körnermais kaum PFC aufnimmt. In Weizen und Triticale können sich PFC dagegen stark anreichern. Die betroffenen Land- und Stadtkreise, Behörden und das baden-württembergische Umweltministerium gaben bereits mehrere Millionen Euro aus, um die Auswirkungen der PFC-Kontamination einzuschränken.
Nun gilt es einen effizienten Mix an Lösungen zu entwickeln und umzusetzen. Bohnert und ihre Kollegen unterstützen diverse Gemeinden. Ihr interdisziplinäres Team vereint Geowissenschaftler, Chemiker, Biologen und Ingenieure. Sie setzen auf pragmatische Lösungsansätze, um die weitere Nutzung der Flächen zu ermöglichen.